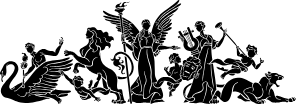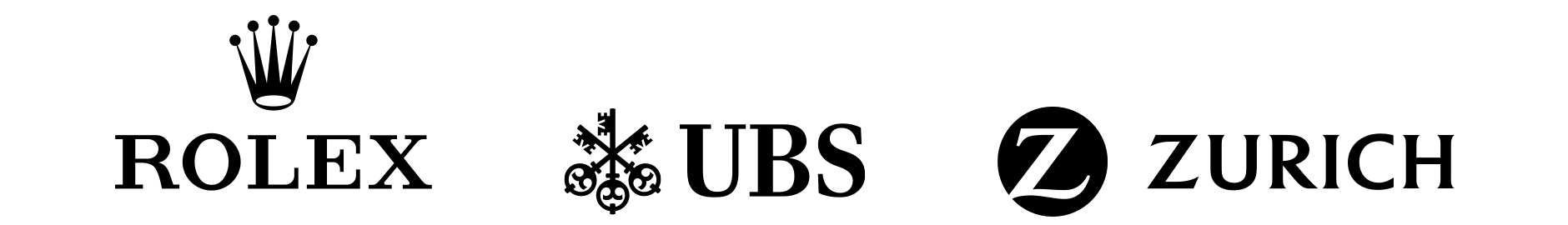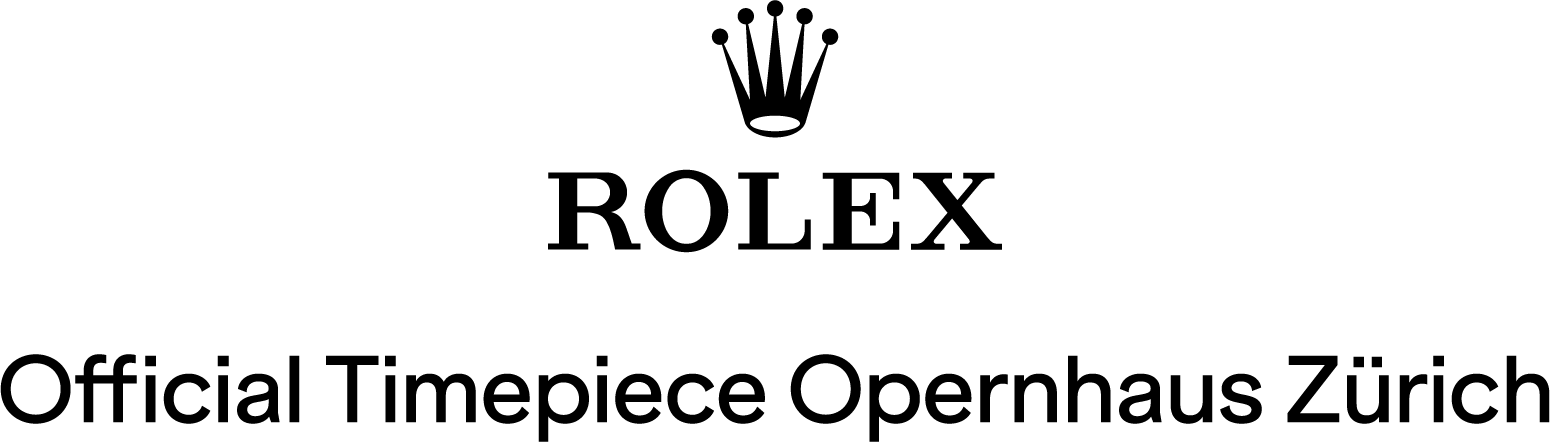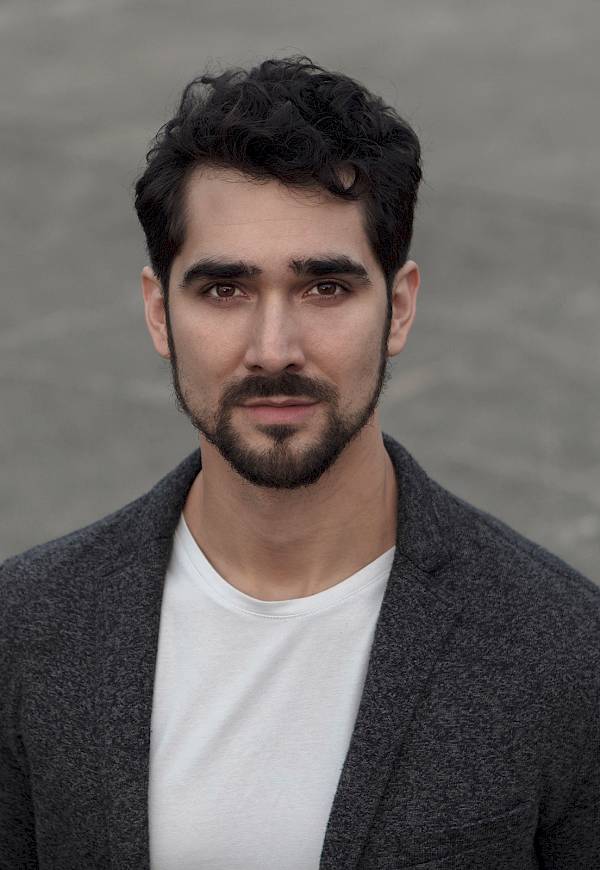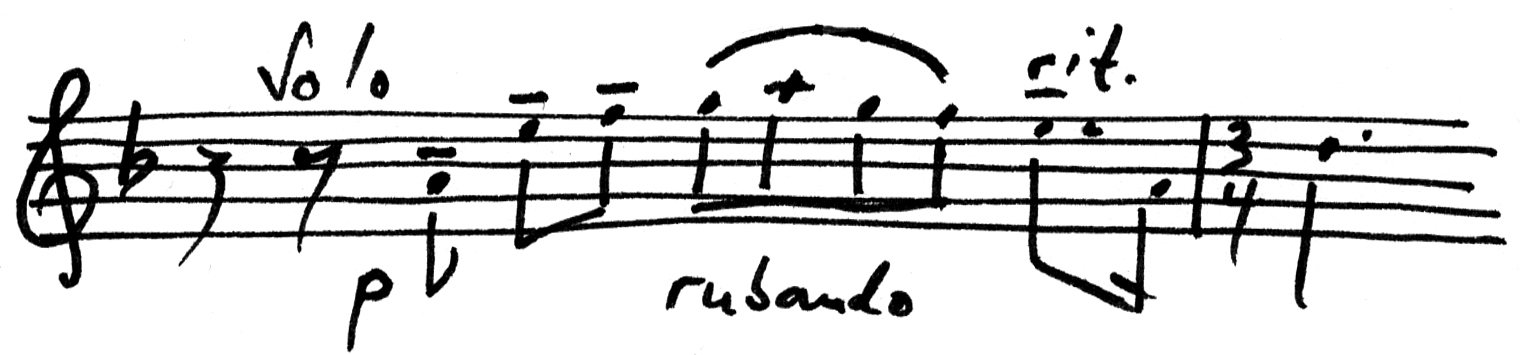Das Motiv der erzwungenen Liebe kommt in vielen Opern vor, etwa in Mozarts Entführung aus dem Serail, wo Bassa Selim grossmütig darauf verzichtet, die Liebe zu Konstanze zu erzwingen. Oder in der Zauberflöte bei Sarastro, der Pamina gefangen hält und in einer schönen Arie verrät, wie es um ihn steht: «Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch geb’ ich dir die Freiheit nicht.» Wenn wir uns daran erinnern, dass es im Unbewussten kein Nein gibt, sagt Sarastro: Wenn ich nur könnte – ich würde dich zwingen. Aber ich bin weise genug, zu erkennen, dass ich das, was ich eigentlich begehre, auf diesem Weg nicht finden werde.
Und dann Tosca. Die Szene des Konflikts ist modern: Ein diktatorisches Regime erpresst durch Folter Verrat. So soll in kaltem Kalkül, das auf die Macht der Angst setzt, jeder Widerstand gebrochen werden. Dann begegnen wir dem Riss im System. Baron Scarpia ist mit der Macht nicht zufrieden, die ihm seine Spitzel und seine Grausamkeit verschaffen – er will auch noch Liebe haben. Hybris, einst ein Fall für die Rache der Götter.
Der mächtige Mann, der Furcht weckt und sich Liebe wünscht, ist eine tragische Figur, die nur durch den Verzicht Grösse gewinnen kann. Wenn er die Macht behalten will, muss er bereit sein, auf die Liebe zu verzichten; das hat bereits Machiavelli unmissverständlich klar gemacht. Scarpia möchte mit den liebevollen Bindungen, die er mit heftigem Neid beobachtet, sein Machtspiel treiben – und doch etwas von ihnen abhaben. Er lässt Cavaradossi foltern, und während dieser schweigt, kann Tosca das Leid des Geliebten nicht ertragen und wird zur Verräterin. Das ist psychologisch gut beobachtet: Eigener Schmerz lässt sich leichter verarbeiten als das Leid eines geliebten Menschen.
Die menschliche Liebe ist aus zwei Elementen komponiert: der sexuellen Lust und der zärtlichen Bindung, die in der Nähe von Mutter und Kind wurzelt. Im Tierversuch hat sich gezeigt, dass Säugetiere (in den Experimenten meist Ratten) für ihre Kinder Schmerzen in Kauf nehmen, die sie weder für Nahrung noch für Sexualpartner riskieren. Menschen sind da nicht besser, aber auch nicht schlechter. Für unsere Bindungen opfern wir mehr als für alles andere. Toscas Angst, Cavaradossi zu verlieren, überkreuzt sich mit der Angst Scarpias, Tosca nicht zu gewinnen. Die stolze Frau, die ihn verachtet, wird für ihn zum Symbol einer Drohung, die er um jeden Preis aus der Welt schaffen möchte.
Wer rätselt, was mächtige Männer antreibt, Liebe zu erzwingen, kann von Scarpia lernen. Es ist nicht so sehr Lust, die er begehrt, es ist vor allem die Angst, der Grenze seiner Macht zu begegnen. Wenn die männliche Machtfantasie derart aufgebläht ist, wie Diktaturen das versprechen, genügt die geringste Ohnmachtserfahrung, um das Selbstgefühl bis in seine Grundfesten zu erschüttern.
Ja, Liebe ist riskant und kann enttäuscht werden. Aber wer auf sie vertraut, gewinnt ein Stück lebendiger Intensität, nach dem sich der Machtmensch vergeblich sehnt. Wo in Trennungskonflikten moderner Paare Liebesenttäuschung nicht betrauert werden kann, sondern in Misstrauen und Vernichtungswillen umschlägt, tragen die Kinder ihr Leben lang eine Last. Sie mögen wissen, dass ihre Eltern sich einmal geliebt haben müssen. Aber erlebt haben sie diese Liebe nie. Wir wissen nicht, ob Scarpia einmal ein solches Kind war, aber es ist gut dokumentiert, dass Menschen durch erlebte Bindungen bindungsfähig werden und Eltern, die vor allem mit Hass beschäftigt sind, wenig Raum für Empathie haben.
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann