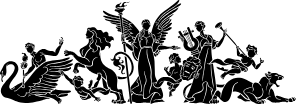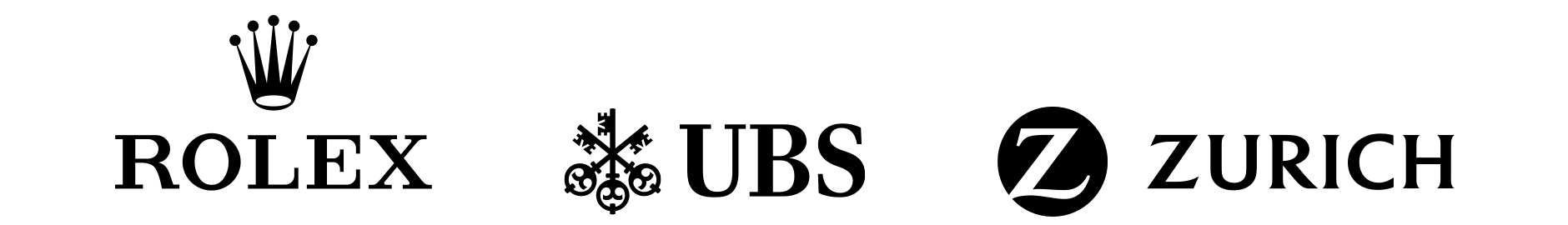Na sowas!
Keine Ahnung, was da passiert ist.
Sie haben eine Seite aufgerufen die nicht, oder nicht mehr existiert. Bitte wählen Sie in der Navigation Ihr gewünschtes Informations-Thema aus oder oder gehen Sie zurück auf unsere Homepage – dort gibt es noch viel mehr zu entdecken.