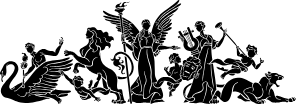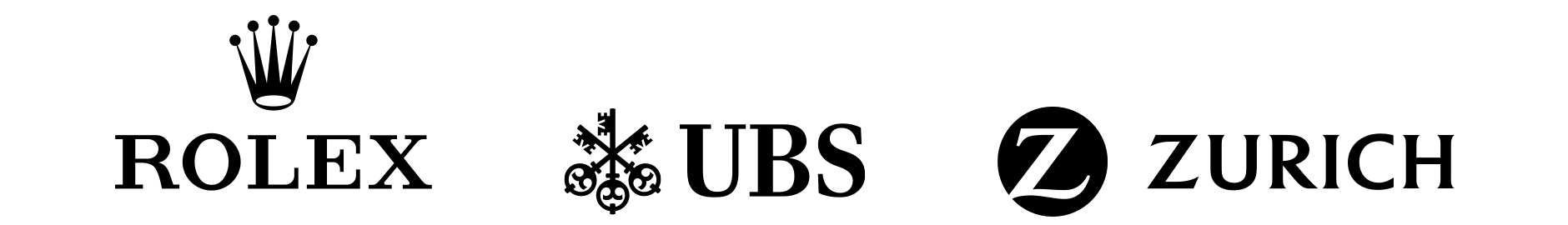Cathy, nach dem grossen Erfolg des Balletts The Cellist widmest du dich in deinem neuen Werk Clara erneut einer grossen Musikerin. Nach der Cellistin Jacqueline du Pré ist es nun Clara Schumann, die bedeutendste Pianistin des 19. Jahrhunderts. Die beiden Künstlerinnen trennen zwar mehr als 100 Jahre, aber hast du trotzdem Verbindungen zwischen den beiden ausfindig machen können?
Wie beide Frauen auf untrennbare, wenn auch ganz individuelle Weise mit ihrer Kunst, der Musik, verbunden sind, erscheint mir als die grösste Parallele. Während ich bei Jacqueline du Pré noch mit Zeitzeugen sprechen konnte, die sie kannten und auf der Bühne erlebt haben, konnte ich im Fall von Clara Schumann nur auf Informationen zurückgreifen, die mir ihre Biografen und ihre Tagebuchaufzeichnungen geliefert haben. Und natürlich auf ihre Musik, die mir viel über sie erzählt. Ihre Persönlichkeiten waren sehr verschieden. Jackies Wildheit ist nicht unbedingt das, was ich mir für Clara vorstelle, aber ich spüre bei beiden die absolute Entschlossenheit, ihr Leben vollständig in den Dienst der Musik zu stellen. Wir reden heutzutage viel über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber wie soll das gehen, wenn man so eine Kunst macht? Das ist fast unvereinbar, wenn der Sinn des Lebens im Musizieren besteht.
Wie bist du mit Clara Schumann in Berührung gekommen, und wie hat diese Idee bis zur jetzigen Umsetzung mit dem Ballett Zürich Gestalt angenommen?
Vor etwa zwanzig Jahren bin ich in einer Sonntagszeitung auf die Rezension einer Biografie von Clara Schumann gestossen. Dieses Buch der schottischen Autorin Janice Galloway hat mich damals in seinen Bann gezogen und mein Interesse an Clara Schumann geweckt. Die Tatsache, dass es keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Romanbiografie war, liess viel kreativen Freiraum, und von Anfang an stellten sich bei mir Bilder von Bewegungen ein. Ich bin dann in den Kosmos der Musik von Clara und Robert Schumann eingetaucht. Dabei hat mich fasziniert, wie beide ihre Musik als verschlüsselten Code ihrer Kommunikation genutzt haben, und mir war klar, dass ich das irgendwann in einem Ballett auf die Bühne bringen würde.
Clara Schumann wurde lange in erster Linie als «die Frau von Robert Schumann» wahrgenommen. Dabei sah das zu Lebzeiten ganz anders aus. Clara Schumann war berühmt, während Robert es schwer hatte, einen Fuss auf den Boden zu bekommen. Warum eignet sich Claras Leben als Stoff für ein Ballett, und auf welche Elemente ihrer Biografie richtest du in deinem Ballett den Fokus?
In ihrem Ringen um künstlerische, menschliche und ökonomische Autonomie ist Clara Schumann im 19. Jahrhundert eine geradezu einzigartige Erscheinung. Im Ballett mache ich das vor allem an den Beziehungen zu ihrem Vater Friedrich Wieck, zu Robert Schumann und zu Johannes Brahms fest. Diese Dreieckskonstellationen sind das Grundgerüst für mein Stück. Wichtig für Claras Persönlichkeit erscheint mir der Umstand, dass sie bis zu ihrem vierten Lebensjahr nicht gesprochen hat. Was kann das bedeuten? Ein Kind, das nicht spricht, kommuniziert nonverbal und durch Bewegung. In der extremen Beziehung zu ihrem Vater Friedrich Wieck geht es in erster Linie um die Musik, um Disziplin, um Aufopferung und Ehrgeiz. Das sind Themen, mit denen sich auch Tänzerinnen und Tänzer unentwegt auseinandersetzen. Diese Nonverbalität setzt sich dann in Claras Beziehung mit Robert Schumann fort. Als erster Mensch gibt er ihr die Aufmerksamkeit, die ihr fehlt. Sie ist elf, er ist zwanzig, da beginnt die schriftliche Korrespondenz, ab da steigern sich ihre gegenseitigen Schwärmereien. Im regelmässigen Wechsel widmen sie einander ihre Kompositionen. Sie fungieren geradezu als Ersatz für das persönliche Gespräch, denn Friedrich Wieck verhindert das Zusammensein der beiden, in dem er das Wunderkind Clara immer wieder auf ausgedehnte Konzertreisen schickt. Auch später scheint es kaum Platz für direkte Kommunikation zu geben. Man schreibt Ehetagebuch oder kommuniziert durch Musik. Vieles liegt im Unausgesprochenen, und das macht es für den Tanz so interessant. Wie in meinem Ballett The Cellist, wo das Cello von einem Tänzer verkörpert wird, habe ich für die Pianistin Clara Schumann nach einer Möglichkeit gesucht, sie in Beziehung zu ihrem Instrument darzustellen. Ausgehend von den sieben Melodietönen einer Tonleiter und den entsprechenden weissen Tasten auf dem Klavier wird Clara deshalb von sieben Tänzerinnen verkörpert. Sie stehen für sieben Facetten ihrer Persönlichkeit, die dem Wunderkind, der Künstlerin, Ehefrau, Mutter, Pflegerin, Managerin und Muse zugeordnet sind. Sie wirken wie eine Gruppe von Schwestern, die das Klavier repräsentieren. Dieser Chor von Claras ist sozusagen die Tastatur, auf der ich als Choreografin spiele.
Wie fügen sich diese sieben Einzelaufnahmen zu einem Gesamtbild zusammen?
Jede der sieben Tänzerinnen ist in einem anderen Kapitel der Geschichte präsent, auch wenn sie sich gelegentlich überlappen und teilweise auch gemeinsame Bewegungsmotive teilen. Sie entwickeln sich aber – in unterschiedlicher Gewichtung – auf individuelle Weise, vor allem – mit Ausnahme der Brahms zugeordneten siebenten Clara-Tänzerin – in ihrem Kontakt zu Robert Schumann. Er ist die eigentliche Hauptfigur des Balletts, der in seiner Person die verschiedenen Clara Figuren miteinander verbindet.
Clara und Robert Schumann gelten bis heute als das ideale Künstlerpaar der Romantik, auch wenn dieses Bild inzwischen einige Risse bekommen hat und die Beziehung nicht ganz so romantisch war, wie uns Tagebücher und manche Biografen glauben machen wollen. Wie reflektierst du diese Verbindung in deinem Ballett?
Wir müssen uns, glaube ich, vor einseitigen Beurteilungen hüten. Von einer romantischen Künstlerehe haben wir heute sicher eine andere Vorstellung. Wer weiss, vielleicht hat es Clara gelegentlich bereut, Robert geheiratet zu haben. Aber das macht diese Ehe als Ganzes nicht zum Desaster. Das wäre wirklich Schwarz-Weiss-Malerei. Die Hochzeit mit Robert bedeutete für Clara, auch seine Fehler in Kauf zu nehmen. Natürlich war es keine Traumehe, in der beide gesund waren, jeden Tag Klavier spielen, komponieren und gemeinsam auf Tournee gehen konnten. Sexualität hat in dieser Beziehung eine wichtige Rolle gespielt. Clara ist unentwegt schwanger, acht Kinder bringt sie zur Welt. Ich habe bei ihr das Gefühl, dass ein Teil von ihr die Frau sein will, die er braucht und die die Gesellschaft erwartet. Ein Teil von ihr will die Konzertpianistin sein, die durch die Welt tourt. Ein Teil von ihr möchte ihn pflegen, weil sie ihn liebt. Ein Teil von ihr fühlt die Verantwortung für die Kinder. Im Tanz lässt sich diese ambivalente Gratwanderung gut einfangen, und deshalb erweisen sich die sieben Clara-Figuren für die Narration als überaus hilfreich.
Wie schon erwähnt, steht Robert Schumann im Mittelpunkt deines Balletts. Nicht als strahlender Ballettheld, sondern als zerrissener Charakter zwischen übergrosser Euphorie und Phasen tiefer Depression. Wie gelingt es dir, deine Robert-Schumann-Darsteller darauf einzuschwören?
Diese emotionalen Berg-und-Tal-Fahrten bei Schumann sind eine echte Herausforderung, weil sie eine grosse Intensität in der Darstellung verlangen. Als Tänzer muss man sich wirklich darauf einlassen. Nur mit Technik und Choreografie kann man dieser Rolle nicht gerecht werden. Man muss in jeden Zustand eintauchen und darf dabei keine Hemmungen entwickeln. Karen Azatyan, unser neuer Erster Solist, mit dem ich die Rolle erarbeite, macht diese Reise wirklich mit. Er setzt meine Vorgaben um, bringt aber auch selbst sehr viele Anregungen in den kreativen Prozess ein. Das ist sehr hilfreich, weil ich selbst mich ja die ganze Zeit in die sieben Claras hineinversetzen und den Überblick behalten muss.
Wie ist Clara als Pianistin in deinem Ballett präsent? Einen Flügel gibt es auf der Bühne ja nicht…
Als Pianistin für unsere Ballettproduktion konnten wir die grosse Clara-Schumann-Spezialistin Ragna Schirmer gewinnen. Ragnas Klavierpart zieht sich wie ein roter Faden durch das Stück. Sie gibt den sieben Claras eine Stimme und steht der zentralen Tanzrolle Robert Schumanns gegenüber. Darüber hinaus ist das Klavier nicht nur im Bühnenbild, sondern auch in den Kostümen allgegenwärtig. Mit unserem Bühnenraum für Clara wollten wir eine Klavierwelt evozieren, in der das Instrument präsent ist, auch wenn man es nicht sieht. Ähnlich wie im Ballett The Cellist, wo Hildegard Bechtler das Innenleben des Cellos zu einer Echokammer, einem Gedächtnisraum entwickelt hat, haben wir jetzt eine Szenerie, die uns in die Welt des Klaviers eintauchen lässt – die rechtwinklige Welt von sieben Tasten, die klar geschnittenen Öffnungen, der geschwungene Korpus, der an den Flügel eines Vogels oder eines Engels denken lässt. Auf einem stilisierten Flügeldeckel entsteht eine inselartige Spielfläche. Es ist der Rückzugsort, an dem die Hochzeit von Robert und Clara stattfindet, aber auch das Symbol für Roberts Jahre in der Endenicher Heilanstalt. Das Bühnenbild verbindet sich mit einer äusserst vielgestaltigen, gefalteten Welt in den Kostümen Bregje van Balens, die ihren Ursprung in Robert Schumanns Klavierpartituren haben.
Für Robert und Clara ist die Begegnung mit dem 20-jährigen Johannes Brahms eine Art Erweckungserlebnis. Er wird zum Freund der Familie und nach Roberts Tod zum treuen Begleiter Claras. Wie weit deren Beziehung später ging, ist immer wieder Anlass für Spekulationen gewesen. Welche choreografische Antwort findest du auf diese Frage?
Zum Glück darf ich eine choreografische Antwort geben und muss nicht behaupten, dass sie Händchen gehalten oder nackt nebeneinander gelegen hätten. Darum geht es auch nicht. Die siebente Clara – ich nenne sie die Muse – hat eine Geste, bei der sie ihre Hand an ihr Gesicht hält. Es ist wie eine Art Mauer mit Robert auf der einen und Brahms auf der anderen Seite, und sie scheint die Sicht auf Robert in der Endenicher Nervenheilanstalt zu versperren. Eine unsichtbare Grenze, wobei ich damit spielen kann, wann und wie diese Linie überschritten wird. Clara nimmt Brahms’ Unterstützung während Roberts Endenicher Asyl und nach seinem Tod an. Aber wenn man das weiterdenkt, kommt man irgendwann in den Bereich der Vermutung und Spekulation. Der Tanz kann diese fliessende Grenze bewahren.
Die Biografien der Protagonisten in deinem Ballett sind aussergewöhnlich gut dokumentiert, nicht nur durch die Tagebücher und erhalten gebliebenen Briefe von Clara, Robert und Brahms, sondern auch durch eine Unmenge von Sekundärliteratur. Wie viel historische Genauigkeit hast du dir selbst für dein Ballett verordnet?
Das entscheide ich von Fall zu Fall. Als ich an The Cellist gearbeitet habe, war das anders, weil einige Protagonisten noch am Leben waren, und ich ihnen gegenüber eine besondere Verantwortung fühlte. Aus den vielen Biografien von Clara, Robert und Brahms kann man viele Fakten und Konstellationen für das Ballett übernehmen. Aber natürlich kann man sich auch fragen, wie zuverlässig diese Quellen sind. Das gilt insbesondere für die Tagebücher, wo manche Einträge und Formulierungen ganz darauf aus zu sein scheinen, für künftige Lesergenerationen ein idealisiertes Bild der romantischen Künstlerbeziehung von Robert und Clara zu transportieren. Und auch bei den vielen Biografien, die es mittlerweile gibt, muss man die jeweilige Perspektive bedenken, aus der sie geschrieben sind. Da muss ich mich fragen, ob das auch meine Perspektive ist und komme unter Umständen zu anderen Ergebnissen. Die zuverlässigste Quelle für mich bleibt die Musik selbst.
Die Ballettpartitur für Clara hat – wie schon bei The Cellist – der britische Komponist Philip Feeney zusammengestellt. Welche Wünsche hattest du an ihn?
Natürlich gab es eine Playlist mit Stücken, die ich unbedingt choreografieren wollte. Ganz oben stand zum Beispiel das Adagio aus Brahms’ Erstem Klavierkonzert, das mir wie ein liebevolles Porträt Claras erscheint. Claras Romanze op. 11 Nr. 3 ist dabei, das Lied Auf einer Burg aus Roberts Liederkreis op. 39 und – ganz wichtig – jenes Thema aus dem Klavierzyklus Bunte Blätter, das sowohl Clara als auch Brahms in eigenen Variationen verarbeitet haben. Clara und Robert sind mit Ausschnitten aus ihren Klavierkonzerten vertreten. Es hat sich ergeben, dass jeder der drei Akte ein anderes musikalisches Zentrum hat. Am Anfang sind es mehrheitlich Kompositionen von Clara, der zweite Akt stellt Robert Schumann in den Mittelpunkt, und am Ende fokussieren wir uns auf Brahms.
Aus den insgesamt mehr als 25 Stücken von Clara Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms hat Philip Feeney einen tiefromantischen Musikkosmos kreiert. Wie wirkt sich das romantische Idiom auf deine choreografische Sprache aus?
Es ist eine Musik, in der ich mich sehr zu Hause fühle. Bei der Arbeit an Clara mache ich gerade ähnliche Erfahrungen wie bei meinem Ballett Jane Eyre, das vor allem auf Musik von Mendelssohn zurückgegriffen hat. Manchmal verleitet einen die Musik zu dramatischem Aplomb. Oft frage ich mich dann, wie weit ich mit den grossen Akzenten gehen kann und muss mich manchmal ein wenig bremsen. Aber oft kann ich einfach in diese Musik eintauchen und mich von ihr treiben lassen. Ich mache keine Anti-Choreografie. Immer wieder muss ich daran denken, was mir Leute in Australien gesagt haben. Wenn man in eine Strömung gerät, darf man auf keinen Fall versuchen, gegen die Strömung zu schwimmen, um wieder an Land zu kommen. Man muss einfach mit ihr fertig werden, bis sie einen wieder zurückzieht.
Clara Schumann hat ihren Mann um 40 Jahre überlebt. Ihre Pianistinnenkarriere hat nach seinem Tod noch einmal gewaltig an Fahrt aufgenommen, sie hat weiterhin für den Unterhalt ihrer Familie gesorgt, war verlegerisch tätig und hat als hochangesehene Professorin in Frankfurt unterrichtet. Eine der letzten Szenen in deinem Ballett ist Roberts Beerdigung. Was ist mit den vierzig Jahren, die für Clara danach noch kommen?
Natürlich sind diese Jahre nicht weniger wichtig für Claras Biografie. Aber auch bei einem abendfüllenden Ballett muss man sich beschränken. Ich wollte deshalb vor allem ein Ende finden, das keinen Schlusspunkt unter dieses Leben setzt, sondern einen Ausblick ermöglicht. Als Brahms und Clara nach Robert Schumanns Tod auseinandergehen, ist das für mich ein Punkt, an dem sie als Mensch und Künstlerin ganz zu sich selbst findet. Wichtig war mir, dass sie am Ende nicht als Opfer erscheint, sondern dass sich da noch einmal eine Tür in diese zweite Lebenshälfte öffnet, die für Clara mit einer anderen Art von Selbstbestimmung und künstlerischer Freiheit einhergeht. Auf der Lebensreise, von der die sieben Claras in unserem Ballett erzählen, ist einiges an Gepäck zusammengekommen. Und sie ist stark genug, um es zu tragen.
Das Gespräch führte Michael Küster.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 115, Oktober 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.